FAQ: Schuld im StGB
Schuld ist laut Definition im Strafrecht die persönliche Vorwerfbarkeit strafbaren Verhaltens. Sie setzt unter anderem voraus, dass der Täter zur Tatzeit schuldfähig war.
Ein Täter darf nur für begangenes Unrecht bestraft werden, wenn er in der Lage war, dieses Unrecht zu erkennen und sich anders zu verhalten. Hier erfahren Sie mehr.
Moralische Schuld lädt auf sich, wer gegen anerkannte sittliche Werte oder gegen sein Gewissen verstößt, obwohl er anders hätte handeln können. Moral und rechtliche Schuld sind zwar eng miteinander verbunden, aber nicht unbedingt identisch.
Inhaltsverzeichnis
Weitere Ratgeber zum Thema:
Schuld als Strafbarkeitsvoraussetzung

Die Schuld spielt im Strafrecht eine wesentliche Rolle: Ein Täter macht sich nur strafbar, wenn er Unrecht begeht, obwohl er in der Lage ist, sich rechtmäßig zu verhalten.
Trifft ihn keine Schuld bzw. kann sie ihm nicht nachgewiesen werden, darf er für die Tat auch nicht bestraft werden. Kurz gesagt gilt also der Grundsatz: Keine Strafe ohne Schuld – oder wie die Juristen sagen: „Nulla poena sine culpa.“
Das bedeutet zunächst einmal, dass die Schuld eine Strafbarkeitsvoraussetzung ist. Ein Täter darf nur dann für sein Verhalten zur Verantwortung gezogen werden, wenn man ihm dieses Verhalten auch vorwerfen kann. Dieser Ansatz der individuellen Vorwerfbarkeit beruht auf dem Gedanken, dass Menschen einen freien Willen haben und deshalb auch anders – rechtskonform – handeln können.
Voraussetzungen für die Schuld im Strafrecht sind:
- Der Täter ist schuldfähig.
- Er hätte zumindest einsehen können, dass sein Verhalten der Rechtsordnung widerspricht (potentielle Unrechtseinsicht).
- Es liegen keine Entschuldigungsgründe vor.
Was ist der Unterschied zwischen Rechtswidrigkeit und Schuld? Rechtswidrig handelt jemand, wenn seine Tat objektiv gegen die Rechtsordnung verstößt. Bei der Schuld im Strafrecht geht es um die Frage, ob dieses strafbare Verhalten dem Täter auch persönlich vorgeworfen werden kann.
Schuldfähigkeit, §§ 19 ff. StGB
Der Täter muss schuldfähig, also in der Lage gewesen sein, das Unrecht seiner Tat zu erkennen und entsprechend zu handeln. Erwachsenen wird diese Willensfreiheitlich grundsätzlich unterstellt und vermutet, dass sie zur Tatzeit schuldfähig waren – es sei denn, es liegen Anhaltspunkte vor, die dagegen sprechen.
Bei Kindern unter 14 Jahren geht der Gesetzgeber unwiderleglich davon aus, dass ihnen die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit fehlt. Sie gelten laut § 19 StGB als schuldunfähig und können deshalb nicht bestraft werden.
Laut § 20 StGB handelt außerdem ohne Schuld im Strafrecht, wer …
- aufgrund eines biologischen Defekts (z. B. Schizophrenie, bipolare Störung, Alzheimer)
- nicht der Lage ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen (Einsichtsfähigkeit) oder
- es einsehen kann, aber trotzdem nicht fähig ist, nach dieser Einsicht zu handeln und sein Verhalten entsprechend zu steuern
(Potentielle) Unrechtseinsicht nach § 17 StGB
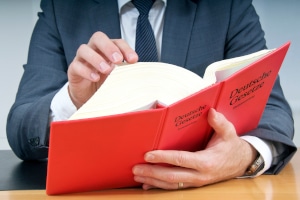
Der Täter hat zumindest ein potentielles Unrechtsbewusstsein, wenn er hätte einsehen können, dass sein Verhalten im Widerspruch zur Rechtsordnung steht.
Fehlt ihm diese Einsicht, so handelt er laut § 17 StGB ohne Schuld, wenn ...
- er sich über die Rechtswidrigkeit seines Handelns irrt und
- er diesen Verbotsirrtum nicht hätte vermeiden können.
Entschuldigungsgründe – Täter handelt ohne Schuld im Strafrecht
In manchen Notsituationen stehen Menschen derart unter psychischem Druck, dass sie sich kaum rechtskonform verhalten können. Das berücksichtigt der Gesetzgeber und befreit Täter, die sich in einer solchen Zwangslage befinden, von der Strafbarkeit.
Derart anerkannte Entschuldigungsgründe sind:
- Notwehrexzess gemäß § 33 StGB, bei dem der Täter die „Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken“ überschreitet
- Entschuldigender Notstand nach § 35 StGB, wenn jemand „in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden“
- Übergesetzlicher entschuldigender Notstand, bei welchem der Täter eine Straftat begeht und weder rechtfertigender noch ein entschuldigender Notstand nach §§ 34 f. StGB vorliegt. Er liegt nur in sehr seltenen Extremsituationen vor, beispielsweise als Ärzte einer Heilanstalt während der NS-Zeit vereinzelte Kranke für den Massenmord (Aktion T4) auswählten, um andere Kranke zu retten.
Schuld im Strafrecht als Grundlage für die Strafzumessung

Stellt das Strafgericht fest, dass sich eine Person strafbar gemacht hat, muss es eine angemessene Strafe aus dem gesetzlich vorgegebenen Strafrahmen festsetzen, die in einem adäquaten Verhältnis zur persönlichen Schuld des Täters und zur Schwere seiner Straftat steht.
Das Gericht fragt sich, wie stark der Täter die Rechtsordnung gestört hat. Ein Beispiel: Ein Autofahrer fährt zu schnell und verletzt dadurch einen Radfahrer. Damit hat er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung nach § 229 StGB strafbar gemacht. Bei der Strafzumessung sind zwei Faktoren zu beachten:
- Vorwerfbare Verbotswidrigkeit (Handlungsunwert): Wie hoch war die Geschwindigkeitsüberschreitung?
- Vorwerfbare Verletzung (Erfolgsunwert): Wie schwer hat der Fahre den Radfahrer verletzt?
Neben der persönlichen Schuld des Täters muss das Gericht bei der Strafzumessung auch berücksichtigen, wie sich die Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft auswirken wird.
Außerdem wägt es alle Umstände ab, die für und gegen den Täter sprechen, insbesondere: Motive (Ziele und Beweggründe) des Täters, z. B. eine fremdenfeindliche oder rassistische Gesinnung, die aus der Tat spricht …
- der vom Täter aufgewandte Wille zur Tatbegehung
- die Art und Weise der Tatbegehung
- die Folgen der Straftat
- mögliche Vorstrafen
- das Verhalten des Täters nach seiner Tat (Bemühung um Schadenswiedergutmachung)
Besondere Schwere der Schuld im Strafrecht

Bei einem Mord kann das Gericht das individuelle Maß der Schuld bei der Strafzumessung nicht berücksichtigen. Denn § 211 I StGB sieht als absolute Strafe „lebenslange Freiheitsstrafe“ vor. Eine Strafmilderung ist – außer bei verminderter Schuldfähigkeit – ebenso wenig möglich wie eine Strafschärfung – bspw. für die Ermordung mehrerer Menschen.
„Lebenslang“ bedeutet in Deutschland auch lebenslang – und nicht 15 Jahre, wie irrtümlich häufig angenommen. Allerdings darf der Täter nach Ablauf der Mindestverbüßungszeit von 15 Jahren die Aussetzung des Rests der lebenslangen Freiheitsstrafe auf Bewährung beantragen.
Stellt das Schwurgericht aber die besondere Schwere der Schuld des verurteilten Mörders fest, so ist diese Aussetzung der restlichen lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Bei der Frage, ob die Schuld des Täters besonders schwer wiegt, würdigt es alle schuldbezogene Umstände.
Allerdings gibt es keinen festen Maßstab dafür, wann die besondere Schwere der Schuld im Strafrecht vorliegt. Deshalb orientieren sich die Strafgerichte an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH):
„Die Schuld des Angeklagten wiegt i.S.d. § 57a StGB dann besonders schwer, wenn das gesamte Tatbild einschließlich der Täterpersönlichkeit von den erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommenden Mordfällen so sehr abweicht, daß eine Strafaussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe nach 15 Jahren auch bei günstiger Täterprognose unangemessen wäre.“
Anhaltspunkte dafür sind z. B. eine besonders kaltblütige Tatbegehung, die brutale oder qualvolle Behandlung des Tatopfers oder rassistische Tatmotive.
Schuldspruch im Strafrecht
Gelangt das Gericht zu der Überzeugung, dass der Täter die Straftat begangen hat, so wird es ihn entsprechend verurteilen. Das Urteil enthält unter anderem den Schuldspruch und den Rechtsfolgenausspruch:
- Der Schuldspruch beinhaltet laut Definition die richterliche Feststellung, ob der Angeklagte die ihm vorgeworfene Tat begangen hat und welchen Straftatbestand er dadurch verwirklich hat.
- Der Rechtsfolgenausspruch umfasst die konkreten Folgen, die sich für den Angeklagten aus der Feststellung seiner persönlichen Schuld ergeben, z. B. die Art und Höhe der Strafe und gegebenenfalls Nebenstrafen oder Maßregeln zur Sicherung und Besserung.
Ein Freispruch trotz Schuld ist im Strafrecht möglich – etwa in vor langer Zeit als ungeklärt zu den Akten gelegt wurden. Ein Beispiel: Der Angeklagte hat sein Opfer nachweislich vorsätzlich getötet – die Tat liegt über drei Jahrzehnte zurück. Mord verjährt zwar nicht, aber dem Täter muss zumindest ein Mordmerkmal, z. B. Habgier nachgewiesen werden. Lässt sich das nicht zweifelsfrei beweisen, muss das Gericht Angeklagten dennoch freisprechen, weil Totschlag nach 20 Jahren verjährt.

Hinterlassen Sie einen Kommentar: